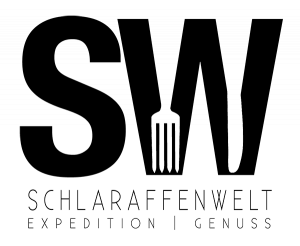„Miso“ ist die Antwort auf viele Küchenfragen. Warum schmeckt das Dressing so rund? Die Sauce so voll? Die Majonnaise so intensiv? Das Dessert so wuchtig? Miso ist in Gläser gefülltes Umami – eine Geheimwaffe für mundfüllenden Geschmack. Dabei ist die Grundformel so einfach: Aspergillus Orizae + Zeit. Den Rest erledigt die Natur.
Was ist Miso: Die Kurzfassung
Miso ist eine fermentierte Paste, die traditionell auf Basis von Sojabohnen, Reis oder Gerste erzeugt wird. Dazu wird das zu fermentierende Produkt (klassisch: ganze Sojabohnen) gedämpft und mit Reis vermengt, der vorher mit dem Schimmelpilz Aspergillus Oryzae („Koji“) geimpft wurde. Zusätzlich wird zwischen 5 und 13% Salz hinzugefügt. Dabei ist es nicht der Pilz selbst, der die die Miso-Fermentation ablaufen lässt, sondern Enzyme, die in der vorhergegangenen Pilzwachstumsphase im Reis entstehen. Somit ist die Miso-Fermentation eine enzymatische Form der Vergärung.
Warum schmeckt Miso so intensiv?
Ein stark vereinfachter Erklärungsversuch: Viele Lebensmittel, die wir roh oder gekocht zu uns nehmen, enthalten auf molekularer Ebene relativ große Bausteine, die unsere Geschmacks-Rezeptoren aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit nur schwach oder gar nicht „auslesen“ können. Im Zuge der Fermentation mit den Enzymen des Koji werden Proteine, Kohlenhydrate und Fette zersetzt und in kleinere „auslesbare“ Einheiten aufgespalten. Aus Proteinen werden beispielsweise Aminosäuren, die als aromatische Nuancen in unterschiedlichste Richtungen wahrnehmbar sein können. Glutaminsäure – ebenfalls ein Nebenprodukt – wirkt als Geschmacksverstärker. Es ist also die Mischung aus durch Enzyme freigesetzten Aromen und verstärkenden Aminosäuren, die die Faszination des Miso-Geschmacks ausmachen.
Zusätzlich enthält quasi jeder Fermentationsansatz wilde Hefen und weitere Bakterienstämme, die entweder aus der direkten Umgebung stammen, oder an den eingemachten Produkten haften. Darunter sind oft Milchsäurebakterien, die Milchsäure und Vitamin C beisteuern. Auch diese fermentationsfördernden Mikroorganismen verstoffwechseln die Paste über die Zeit und tragen zu einem komplexen und einzigartigen Geschmacksprofil bei. Durch die vom Koji stark vereinnahmte Nährstoffumgebung werden sie allerdings so weit in Schach gehalten, dass sie nicht die makrobiotische Führung übernehmen und daher auch geschmacklich subtil im Hintergrund unterstützen.

Die Basis von Miso: Koji
Miso ist nur eines von verschiedenen Erzeugnissen, denen der Edelschimmel „Koji“ zugrunde liegt. Koji selbst wurde im VI. Jahrhundert entdeckt, als Parasit auf einer Getreide-Ähre. Während andere Getreide-Schimmel Stoffe enthalten, die für den Menschen giftig sind (z.B. Mutterkorn), stellte man fest, dass der Aspergillus Oryzae für den Menschen unschädlich ist.
Die (für Miso) entscheidende Eigenschaft des Aspergillus Oryzae ist, dass er im Verlauf seiner Blüte, die sehr schnell entsteht, Enzyme freisetzt, die spannende kulinarische Auswirkungen haben. Diese enzymatischen Eigenschaften und ihre aromatischen Endprodukte macht man sich seither im asiatischen Raum zunutze, um Sake, Sojasauce und Miso herzustellen. All diese Produkte zeichnen sich durch einen intensiven, runden und vollmundigen Geschmack aus. Dieses Phänomen, das auch als „Umami“ (der 5. Geschmack) bezeichnet wird, ist auf die enzymatischen Prozesse zurückzuführen, die der Koji mit seinen Enzymen ermöglicht. Koji ist also gewissermaßen die Basis, aber nicht zwangsläufig selbst das Vehikel für die chemischen Reaktionen und die Geschmacksausprägung. Das lässt sich sehr gut daran zeigen, dass der Koji-Pilz im Miso oftmals stirbt. Die freigesetzten Enzyme arbeiten allerdings so lange weiter, bis sie kein zerlegbares Material mehr finden. Und das kann Jahre bis Jahrzehnte dauern. Dabei wird das Aroma immer extremer und komplexler.
Wie „züchtet“ man Koji
Man muss Koji nicht züchten, man kann den durchpilzten Reis auch frisch kaufen und direkt zur Misoherstellung verwenden. Wer dennoch selbst Koji züchten möchte, kann hier weiterlesen.
Koji ist ein Pilz und wie jeder Pilz verbreitet sich auch Aspergillus Oryzae über Sporen, die an den reifen Fruchtkörpern wachsen. Während bekanntere Pilze (Steinpilz, Pfifferling etc) gut sichtbare Fruchtkörper mit Hüten hervorbringen, bildet der Koji lediglich einen leichten Flaum – ein Schimmelpilz eben. An diesem Flaum befinden sich die Sporen. Mit einem reifen Koji kann man also einen neuen Koji „züchten“. Dazu muss man allerdings das richtige Substrat als Untergrund und das richtige Klima wählen.
Koji wächst im Grunde überall. Am leichtesten allerdings auf stärkehaltigen Oberflächen, in die er leicht eindringen kann. Klassischerweise wird dazu eingeweichter und gedämpfter Reis genutzt, der leicht aufgequollen aber nicht verkocht ist. Die Koji-Sporen werden auf diesen Reis aufgebracht. Anschließend wird der Koji-Reis bei hoher Luftfeuchte und bei etwa 30-40 Grad aufbewahrt – das sind seine idealen Wachstumsbedingungen. Für Einsteiger eignet sich zum Beispiel ein Backofen, bei dem nur das Licht eingeschaltet wird, während die Koji-Brut immer wieder leicht mit Wasser besprüht wird. Das nächste Level wäre ein Gärautomat – die Endstufe ein Reiferaum mit programmierbarer Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es funktioniert aber in allen drei Varianten. Koji ist nicht besonders sensibel. Man kann es ihm nur leichter oder schwerer machen.

Die Sporen kann man übrigens auf unterschiedliche Art und Weise „sähen“: Entweder man gibt den reifen Reis in eine Dose mit kleinen Löchern (wie ein großer Salzstreuer) und schüttelt den Koji über dem neuen Substrat aus. So fallen die Sporen hinab, während die Reiskörner im „Sieb“ bleiben. Genauso gut kann man aber die ganzen durchwucherten Reiskörner mit dem gedämpften frischen Reis vermengen. Auch so findet der Sporenkontakt zum frischen Reis statt. Hier ist natürlich zu beachten, dass der Pilz, wie die meisten Mikroorganismen, kein beliebig hohes Erhitzen verträgt. Das frisch gedämpfte neue Substrat sollte also auf jeden Fall soweit abgekühlt werden, dass es unter 50 Grad fällt.
Das Reisgemisch wird nun auf ein Holzbrett gegeben und zu einem kleinen Berg aufgetürmt. Nach etwa 24 Stunden entwickelt sich durch das Wachstum des Pilzes eine spürbare Wärme im Inneren des Koji-Bergs. Das ist das Zeichen dafür, dass man den Koji-Reis nun gleichmäßig auf dem Brett verteilen kann. Nach weiteren 24 Stunden sollte der gesamte Reis von einem feinen weißen Schimmel überzogen sein. Dann ist der Koji-Reis reif und kann z.B. für die Miso-Herstellung verwendet werden. Denn nun ist der vormals frische Reis voller Enzyme für eine enzymatische Fermentation. Wer den Ansatz zur „Zucht“ verwenden möchte, sollte dem Pilz noch ein oder zwei Tage mehr geben, um vollständig in die Blütephase überzugehen.
Das Tolle an Koji: Man kann ihn perfekt aufbewahren und hat so eine Starterkultur für unzählige neue Generationen Koji parat. Dazu kann man ihn entweder einfrieren oder trocknen. Der Pilz und seine Sporen werden dadurch nicht getötet, sondern lediglich in Standby versetzt. Wird er nach Monaten wieder mit Wasser und Wärme in Kontakt gebracht, wird er zurück zum Leben erweckt. So kann man sich mit einer großen Portion Koji im Gefrierfach die Starterkultur für viele Miso-Ansätze und neuen Koji-Generationen auf Vorrat halten.
Etwas Verwirrung stiftet übrigens der Begriff: „Koji“ steht sowohl für den Pilz selbst, als auch für den vom Pilz durchwucherten Reis. Daher verwenden wir hier den Begriff Koji-Reis.

Wie wird aus Koji Miso?
Es gibt für Miso nicht DAS EINE Rezept – Miso ist vielmehr ein Prinzip, das unendlich viele Rezepturen zulässt. Das Prinzip ist immer das Folgende:
Es braucht eine gewisse Menge Koji-Reis (theoretisch kann es auch Koji-Soja oder Koji-Gerste sein), als Initiator für die enzymatische Fermentation. Die Faustregel lautet: Mindestens ein 1/3 des Ansatzes sollte Koji sein. Dazu kommt das Basis-Lebensmittel, das mit Hilfe der Koji-Enzyme zu Miso fermentiert werden soll. Zuletzt wird ungefähr 5-13% Salz zugegeben. Je mehr Salz, desto länger kann fermentiert werden und desto stabiler ist die Mischung, aber desto salziger wird auch das End-Miso.
Zum Feuchtigkeitslevel kann man sagen: Die Masse sollte deutlich trockener wirken als Apfelmus, eher wie ein Knödelteig. Man sollte aus der Mischung problemlos eine Kugel formen können, ohne, dass die Hände matschig werden. Zu viel Feuchtigkeit bietet unerwünschten Bakterien ein gutes Wachstumsmilieu, gerade in der Anfangsphase, wo sich das Miso auf makrobiotischer Ebene noch stabilisieren muss.
Man kann sich das so vorstellen: Salz und Feuchtigkeit sind die Parameter, die über die Stabilität des Misos entscheiden: Bakterien mögen Feuchtigkeit, aber kein Salz. Je mehr Wasser und je weniger Salz verwendet wird, desto höher die Chancen, dass sich auch unerwünschte Organismen im Miso breit machen. Gleichzeitig will man aber nicht immer ein sehr sprödes, salziges Miso. Man muss sich also – unter Berücksichtigung dieser Regel – langsam an die richtige Konsistenz und das ideale Salzlevel rantasten.
Basis-Rezept für selbstgemachtes Miso
Ein klassisches Rezept für „einfachen“ Shiro Miso lautet:
Die Sojabohnen werden dazu einen Tag lang eingeweicht und fünf Stunde gedämpft. Nach einer kurzen Abkühlphase vermengt man sie mit dem Koji-Reis und dem Salz. Die Temperatur spielt hier übrigens keine so essentielle Rolle wie bei der Koji-Zucht: Der Pilz selbst hat zu diesem Zeitpunkt schon seine Rolle erfüllt und wird voraussichtlich sowieso sterben. Die Enzyme, die die weitere Arbeit nun übernehmen werden, sind hingegen deutlich temperaturtoleranter und kommen auch mit einem sehr heißen Substrat zurecht. Ein bisschen Abkühlen lassen lohnt sich dennoch, einerseits um sich beim Mischen nicht die Finger zu verbrennen, andererseits um noch mal einen gewissen Wasseranteil verdampfen zu lassen – im Zweifel kann später wieder etwas hinzugefügt werden.
Die Mischung wird nun in ein Glas gedrückt. Dabei sollte man darauf achten, dass keine Luft-Einschlüsse entstehen denn diese bieten wiederum unerwünschten Bakterien Raum und vor allem Sauerstoff, sich zu entfalten. Die Oberfläche wird zum Schluss mit einem reifen Miso „versiegelt“ – dieser Trick ist doppelt sinnvoll: Das reife Miso ist eine ultra-stabile Umgebung, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt und den noch instabilen Misoansatz darunter schützt. Zusätzlich können die Mikroorganismen des reifen Misos als Verstärkung in die neue Masse eindringen und so das Erreichen eines stabilen Zustands in der Anfangsphase weiter unterstützen. Nun kann das Miso – je nach Zutaten – sehr lange reifen. Mindestens sechs Monate sollten es sein. Danach wird das Miso immer dichter, dunkler und intensiver.
Wichtiger Tipp: Bei hohen Temperaturen reift Miso schneller als bei niedrigen. Man kann durch den Lagerort also auch die Reife-Geschwindigkeit steuern.

Welche Lebensmittel eignen sich, um daraus Miso zu machen?
Nehmen wir also an, wir verwenden Reis-Koji als Start-Ferment: Nun kann man jedes erdenkliche Lebensmittel damit vermischen und zu Miso fermentieren. Hier ein paar Beispiele zur Inspiration, an denen wir uns versuchen werden:
- Rote Bete Miso
- Erbsenmiso
- Kürbismiso
- Walnussmiso
- Pilzmiso
- Kastanienmiso
- Tomatenmiso
Welche Grundregeln gilt es zu beachten?
Je mehr Kohlenhydrate ein Miso enthalten, desto süßer wird es und desto weniger lang kann es gelagert werden. Dabei spielt auch der Anteil an Koji-Reis eine große Rolle, da Reis selbst ebenfalls ein Kohlehydrat-reiches Lebensmittel ist. Der Hintergrund der verkürzten Reifeempfehlung ist dabei die Maillard-Reaktion. Das Phänomen, bei dem durch hohe Hitze Zucker erst in Karamellnoten, dann in eine braune Kruste übergeht und womöglich dann verbrennt, kennen wir vom Fleischbraten. Genau dasselbe Prinzip können auch unsere Koji-Enzyme bewirken – ganz ohne Hitze, dafür viel, viel langsamer. Ein stärkehaltiges Miso wird also in den ersten 6 bis 12 Monaten süße Karamellnoten entwickeln. Lässt man die Paste weiter reifen, kippt sie spätestens ab Jahr 3 geschmacklich in Richtung einer verbrannten Kruste.